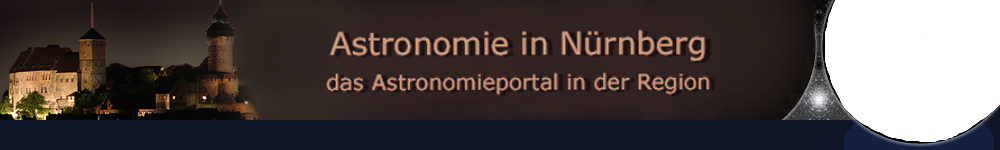Briefwechsel Peter Kolb
| Kurzinformation zum Brief | Zum Original |
| Autor | Kolb, Peter (1675-1726) |
| Empfänger | Seba, Albertus (1665-1736)[1] |
| Ort | Amsterdam |
| Datum | 2. Oktober 1714 |
| Signatur | UB Tartu: Epistolae autographae CC Philosophorum cel. II. F 3,Mrg CCCLIVa, Bl. 332r |
| Transkription | Hans Gaab, Fürth |
Amsterdam, den 2. October 1714
[Praesentatonsnotiz: praesent: die 9. October 1714.]
Mijn Heer
UE geliefdes Schrijvens van den 14 passato is mij well ter hands gekoomen, den inhoud, en mij doer UE van Sijn Excellenz den Heer Doctor Göeckel[2] op gedraagene ordre om den mooren off neger jungetie[3], voor Haer Hooch vorstelijcke Doorl. van Baaden[4] te koopen. Soo hebbe, sulcks niet gemanqueert, waer te neehmen, maer sulcks moed soo bedectelijck geschieden, dat daer geen mens van gewaer word, wand men mach hier geen Coopenschap in dit Land met mensen doen, Sij moogen mooren sijn off niet![5] gevolglijck durft men daar ook geen Coopbriven van maaken. Dat sulcks hier in Amsterdam uijt quaam ick wass een geruineert mann, en mijn leeven niet seeker, en neehme een groot Hasart over mij, buijten de geringste voordeel daar aen te hebben als moijte [Mühe], maar sulcks geschied enckel uijt geneegenhijt voor Haare Hooch vorstelijcke doorlughtighijt en sijn Excellenz den Heer gehijme Raath Göeckel. en als ick daer niet van geschreeven hadde soude het niet beginnen met veel moijte hebbe hem tot 110 Rth (Rijksdaalders?) vor een verEhring [Geschenk] aen den Herr Pater verkreegen, en soude absolut 10 Rthr van een ander meehr hebben konnen bekoomen. Veerders ik tot UE dienst kan Sijn gelieft te ordineeren. Breeder [ausführlicher] hebbe de Heer Doctor Göeckel selft geschreeven. waer meede naer [nach] seer vriendelijcke Groetenise [Grüße] ben en verblijve
Mijn Heer
UE ??Dinaer
Albertus Seba
Fußnoten
- ↑ Albertus Seba (1665-1736) aus Ostfriesland betrieb seit 1700 eine
bedeutende, besonders auf die Bedürfnisse von Seeleuten spezialisierte Apotheke in Amsterdam
("Deutsche Apotheke"). Durch seine Naturalienkabinette und die zugehörigen
großzügigen Publikationen gewann er wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung.
Seba stand auch in Briefkontakt mit den Nürnberger Medizinern Christoph Jacob Trew (1695-1769) und Johann Georg Volkamer (1662-1744).
Die Österreichische Nationalbibliothek in Wien besitzt zwei Porträts von Seba: Porträt 1 Porträt 2- Literatur
- Ahlrichs, Erhard: Albertus Seba. In. Biographisches Lexikon für Ostfriesland, Band 2. Aurich 1997, S. 332-335
- ↑ Zu Christian Ludwig Goeckel (1662-1736), seit 1702 Leibarzt der badischen Markgrafen und seit Herbst 1713 Gastgeber Peter Kolbs in Rastatt, vgl. dessen Brief an Scheuchzer vom 25.08.1714.
- ↑ "Bestellbriefe" für möglichst junge und schwarze Kammermohren,
die an deutschen Höfen als besonders prestigeträchtiger Teil der Dienerschaft hochbegehrt waren,
sind aus dem 18. Jh. mehrfach überliefert. Vgl. zur Praxis und juristischen Bewertung derartigen Sklavenhandels
die angeführte Literatur
- Mallinckrodt, Rebekka von: Beyond Exceptionalism: Traces of Slavery and the Slave Trade in Early Modern Germany 1650-1850. Berlin: de Gruyter 2021
- Mallinckrodt, Rebekka von (Hrsg.): The European Experience in Slavery, 1650-1850. Berlin: de Gruyter 2024.
- ↑ "Ihre hochfürstliche Durchlaucht",
die Markgräfin Franziska Sibylla Augusta von Baden (1675-1733) regierte seit dem Tod ihres Gatten 1707
anstelle ihres Sohnes, des unmündigen Erbprinzen Ludwig Georg Simpert (1702-1761).
In ihrem Hofstaat gab es mindestens zwei Kammermohren, Lovis Abtulla und Philipp.
Zu den zahllosen höfischen Porträts des 17. und 18. Jahrhunderts, auf denen Kammermohren assistieren,
gehört auch ein markantes Kinderbildnis Sibylla Augustas, auf dem ihr ein kniender Knabe eine Tulpe überreicht.
- Vetter, Gerlinde: Zwischen Glanz und Frömmigkeit. Der Hof der badischen Markgräfin Sibylla Augusta. Gernsbach 2006, S. 44, 152, 186
- ↑ Zur rechtlichen Bewertung der Sklaverei in den Niederlanden
vgl. die angegebene Literatur. Die noch unzulänglich erhellte Situation ist offenbar durch das
spannungsvolle Nebeneinander von free-soil-Prinzip und lokalen Skavereiverboten einerseits und der
Selbstverständlichkeit des Rechtsinstituts außerhalb des Mutterlandes, etwa im
Herrschaftsbereich der VOC, gekennzeichnet. Im vorliegenden Fall wird das Verbot förmlicher
Verkaufsakte offenbar durch "Geschenke" umgangen.
- Holzmann, Julia: Geschichte der Sklaverei in der niederländischen Republik. Recht, Rassismus und die Handlungsmacht Schwarzer Menschen und People of Color, 1680-1863. Bielefeld: Transcript 2022, insbesondere S. 80-82.