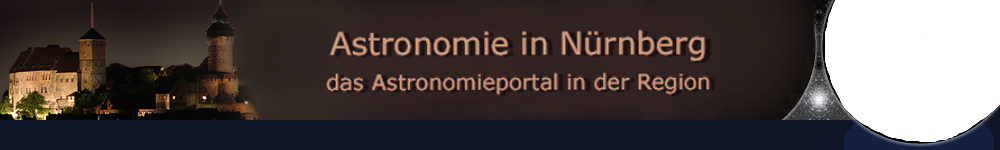Galilei und Marius
| zurück zur Seite 44 | zur Hauptseite | weiter zur Seite 46 |
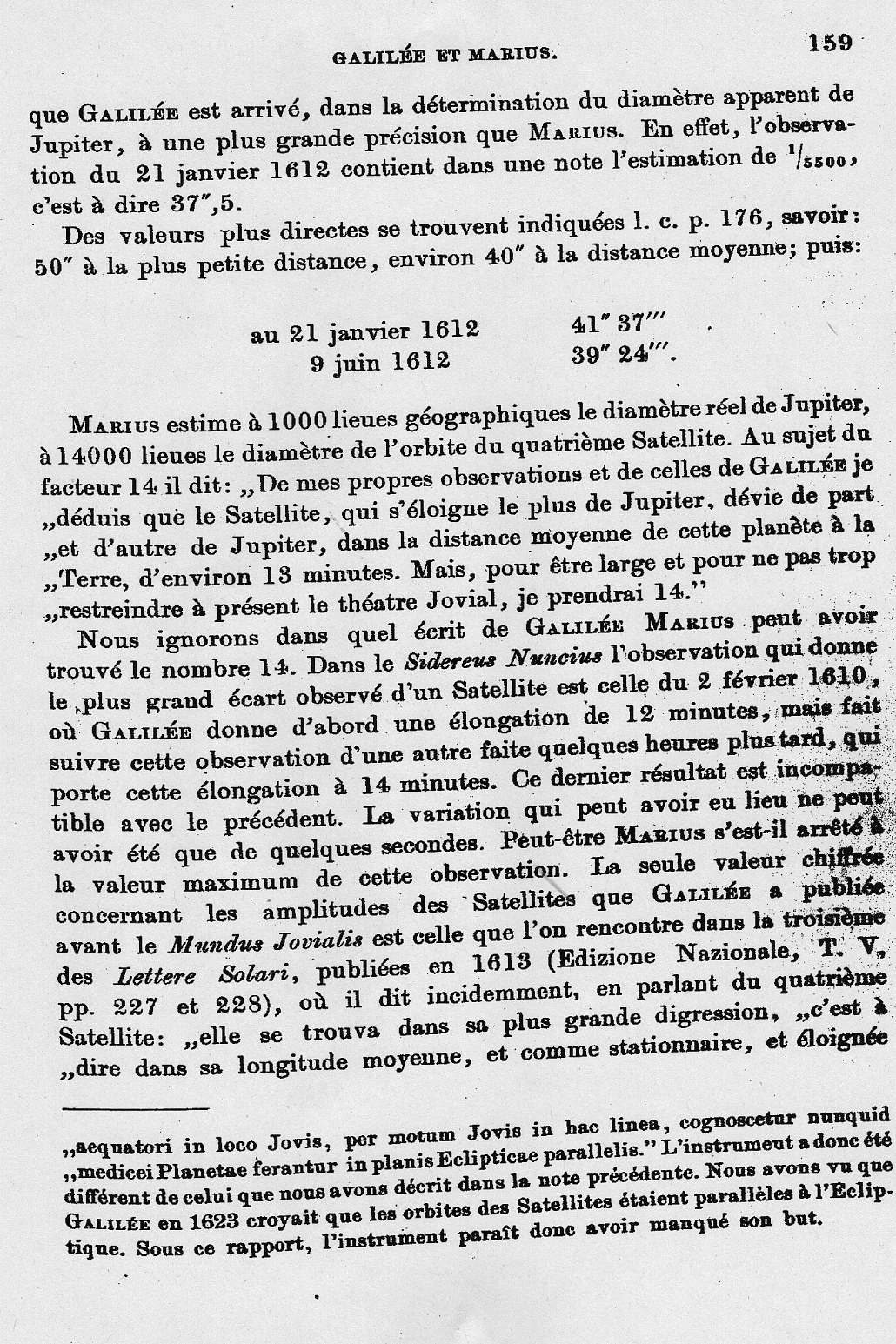
... dass Galilei bei der Bestimmung des scheinbaren Durchmessers von Jupiter eine deutlich größere Genauigkeit als Marius erreicht hat. In der Tat enthält die Beobachtung vom 21. Januar 1612 in einer Anmerkung eine Abschätzung [des Verhältnisses des Durchmessers von Jupiter zu seinem Bahnradius] auf 1/5500, das sind 37''5 [für den scheinbaren Durchmesser von Jupiter].[1]
Mehr direkte Werte finden sich l. c. S. 176: 50'' für die kleinste Entfernung, etwa 40'' für den mittleren Abstand; konkret:
| am 21. Januar 1612 | 41'' 37''' | ||
| 9. Juni 1612 | 39'' 24''' |
Marius schätzt den tatsächlichen Durchmesser von Jupiter auf 1000 geographische Meilen, und den Durchmesser der Bahn des vierten Satelliten auf 14000 Meilen. Über den Faktor 14 sagt er:[2] "Es wurde durch meine eigenen Beobachtungen und durch die des Galilei herausgefunden, dass der vierte Mond des Jupiter, das ist der, der die größte Elongation von Jupiter hat, in mittlerer Entfernung des Jupiter von der Erde ungefähr 13 Winkelminuten auf beiden Seiten abschweift. Ich will aber einmal 14 Minuten annehmen, um recht großzügig zu sein und diesen Umkreis des Jupiter nicht allzusehr einzuengen."
Wir wissen nicht, warum Marius im Zusammenhang mit der Zahl 14 Galilei erwähnt. Im Sternenboten ist die Beobachtung mit dem größten Abstand eines Satelliten die vom 2. Februar 1610, wo Galilei die größte Elongation mit 12 Minuten angab, macht aber nach dieser Beobachtung einige Stunden später eine weitere, die nun die Elongation mit 14 Minuten angibt.[3] Diese letzter Beobachtung ist mit der vorhergehenden unvereinbar. Die Abweichung, die möglicherweise aufgetreten ist, kann nur einige Sekunden betragen haben. Vielleicht hielt Marius seinen größten Wert auf Grund dieser Beobachtung fest. Der einzige bezifferte Wert über die Amplituden der Satelliten, die Galilei vor dem Mundus Jovialis veröffentlich hat, ist der aus dem dritten Sonnenbrief von 1613 (Edizione Nazionale, Band V, S. 227f.), wo er nebenbei über den vierten Satelliten sagt: "Er befand sich in seiner größten Elongation, d.h. in seiner mittleren Länge und stationär, und der Abstand...
Fussnoten
- ↑ [Anmerkung des Bearbeiters] "Diameter Jovis ad Semidiametrem sui orbis est ut 1 ad 275, dum per telescopium spectatur: quod si telescopium lineas multiplicat in ration 20 ad 1, erit vera ratio diametris Jovis ad semidiametrum sui orbis ut 1 ad 5500" (Alberi, Eugenio: Galilaei et Renierii In Jovis satellites lucubrationes quae per ducentos fere annos desiderabantur. Florenz 1846, S. 83).
- ↑ [Anmerkung des Bearbeiters] Vgl. Marius, Simon: Mundus Jovialis.
Nürnberg: Lauer 1614, Bl. A1v.
Die Übersetzung folgt der von Joachim Schlör von 1988, S. 59. - ↑ [Anmerkung des Bearbeiters] Vgl. Galilei, Galileo: Sidereus Nuncius.
Venedig: Baglionus 1610, Bl. F2v (dort auch die Skizzen).
In deutscher Übersetzung: " Am 2. sah man die Sterne in folgender Anordnung:
nur ein Stern stand östlich vom Jupiter in einer Entfernung von 6'; der Jupiter war von dem näheren westlichen 4' entfernt; zwischen diesem und dem westlichen war ein Abstand von 8'. Sie lagen haargenau auf einer Geraden und hatten ungefähr dieselbe Größe. Aber um die siebte Stunde waren vier Sterne da:
zwischen denen der Jupiter die Mitte einnahm. Von diesen Sternen stand der östlichste 4' von dem anschließenden ab, dieser vom Jupiter 1' 40''; der Jupiter war von dem ihm näheren westlichen 6' entfernt, dieser vom westlichsten 8'. Alle lagen gleichfalls in einer geraden Linie, die entlang der Tierkreislinie verlief" (Galilei, Galileo: Nachricht von neuen Sternen. 2. Auflage. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002, S. 120).